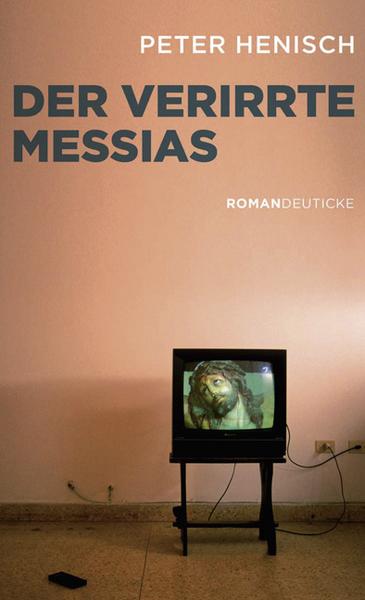Oliver Jungen, F.A.Z. 22.12.2009
Karl-Markus Gauß, Neue Zürcher Zeitung 12.10.2009
Walter Grünzweig, Der Standard 25.7.2009
Peter Pisa, Kurier 25.7.2009 – Rezension und Interview
Brigitte Schwens-Harrant, Die Presse 31.7.2009
Norbert Mayer, Die Presse 8.8.2009 – Interview
Christian Schachenreiter, OÖ Nachrichten 12.8.2009
JESUS WAR EIN FRÜHCHEN
Oliver Jungen, F.A.Z.
Die Wandlung des biblischen Mythos in aufregende Prosa: Peter Henisch hat einen sensiblen Sensationsroman geschrieben, der uns Weihnachten verbittersüßt.
Ungeheuerlich, dass niemand bislang darauf gekommen ist. Dabei erklärte das vieles, das Ausbleiben des Weltendes zum Beispiel, vor allem aber das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom: bis zuletzt ruhelos, von einer Wunderlichkeit zur nächsten jagend. Jetzt ist es also heraus: Jesus war ein Frühchen, deshalb auch so unbequem zur Welt gekommen, verfrüht um die kosmische Winzigkeit von zweitausend Jahren: „Konnte es wirklich so gewesen sein? Dass er damals einfach zu früh in die Welt gefallen war? Dem Mädchen Mirjam in den Schoß gefallen? Das wäre ein Navigationsfehler mit fatalen Folgen.“
Wer fragt sich das? Es ist der hochsensible, dreißigjährige Mischa, der nicht umsonst Myschkin heißt wie Dostojewskis „Idiot“, die große Erlösergestalt der Moderne, sondern der sich auch Jeschua nennt, Mischa also, der Berufene, der Wiedergekehrte, der verirrte Messias auf tiefenpsychologischer Regressionsreise: „Und indem er vorwärtsging, hatte er das Gefühl, eigentlich zurückzugehen, zurück, zurück … Und nachdem er dann vorne, im Chor, über eine der Treppen (die linke), in die sogenannte Geburtsgrotte hinuntergestiegen war, habe er das Gefühl gehabt, endgültig im Uterus angelangt zu sein.“ In der Geburtskirche wird er heimgesucht vom Geist der Erinnerung – eigenen und kollektiven: „Die tragen wir doch alle in uns, wir müssen sie nur aktivieren. Manchmal werden sie uns vielleicht auch gesandt“ – und es wiederholt sich die augustinische Urszene, jedoch in leichter Abwandlung: Statt „Nimm und lies“ befiehlt ihm der Geist zu schreiben. Empfängnis ist in der Postmoderne zwar immer schon Sendung, hier aber geht es darum, dass die Tradition ab ovo überschrieben, dass ein ungeheuerlicher Irrtum korrigiert werden muss.
Mit viel theologischem Sachverstand und einer wohltuenden Portion Humor hat Peter Henisch Platons Anamnesis-Konzept mit der Heilsgeschichte kurzgeschlossen und daraus ein so bibelfestes wie den christlichen Glauben erschütterndes Mythos-Märchen geschaffen. Es ist charmant, dass sein leicht autistischer Held sich selbst erst im Laufe der Geschichte immer sicherer wird, was er im Gelobten Land eigentlich will: das größte Rätsel lösen nämlich. Die Frühchen-These zu Ende zu denken hieße schließlich, dass das Ende der Geschichte (in jeder Hinsicht) noch nicht erreicht wurde, dass man in einem Interim gefangen ist seit zwei Jahrtausenden. So wird es eine „Fahrt, von der viel, vielleicht alles, abhängt“. Und noch charmanter ist es, die imitatio christi ebenfalls in die andere Richtung auszubuchstabieren, alle Selbstzweifel, Sensibilität und Verwirrung auch dem Vorläufer, dem Bautischler aus Nazareth zuzugestehen, der hier gleichfalls orientierungslos durch die ganze Affäre stolpert. So kann über viele hundert Seiten eine Pointe reifen, die es in sich hat.
Wir erfahren vom Heiland 2.0 – wie es sich gehört – nur über eine Vermittlungsinstanz und insofern sehr konjunktivisch: Die Literaturkritikerin Barbara lernt den neurotischen Protagonisten auf einem Flug nach Tel Aviv kennen, bei einer Zwischenlandung im heiligen Rom noch näher kennen und empfängt nach ihrer Rückkehr Briefe des (so oder so) Erwählten. Im ersten Brief erklärt er, wann die Stigmata bluten, nur in bestimmten Erregungszuständen nämlich: Das hatte Barbara in der römisch-elegischen Nacht einen Schock versetzt. Mischa erweist sich dabei durchaus als Ironiker, ausgerechnet die Drogen- und Sexhymne „Let It Bleed“ der Rolling Stones nämlich habe ihm geholfen, die Bluterei zu ertragen. Von nun an berichtet er Barbara – und diese uns – detailliert über seine Reise zum Mittelpunkt der Lehre.
Von Nazareth aus pilgert dieser Jesus-Freak Jesu Leben ab, über das alte Sepphoris, Kana, vorbei am See Genezareth, den Jordan entlang, über Bethlehem, Tiberias und weitere geschichtsträchtige Orte bis nach Jerusalem, weicht aber immer häufiger von der vorgegebenen Route ab, auf der Flucht vor einem immer wieder auftauchenden „mutmaßlichen Clown“, dem Bösen in aktueller Gestalt: „Hingegen ähnelte er immer mehr dem nicht allzu lange Zeit zuvor gefeuerten amerikanischen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld.“ Ebenso durchlebt der von Rumsfeld Gejagte in Wiederholung die Annäherung Jesu an seine Gefährtin. Hier hält es der Autor, der überhaupt dem Körperlichen sein Recht zukommen lässt, mit den Apokryphen: Die Rolle der Maria Magdalena spielt Olga, die Frau eines russischen Oligarchen. Mehr und mehr wandelt sich die Reise im gegenwärtigen Israel allerdings zu einer Passionsgeschichte eigener Couleur. Der perpetuierte Kriegszustand, „die Kontinuität des alltäglichen Horrors“, spielt dabei eine gewisse Rolle, doch nicht daran verzweifelt der Held zuletzt.
Wir erfahren all das aber nicht mehr chronologisch, denn es gibt eine Zäsur in der Überlieferung: Bevor die Briefe nicht mehr eintreffen, hat sich die eifersüchtige Adressatin von ihnen bereits abgewandt. Mischa begegnet erst wieder als Gebrochener, die Konversion zum Islam erwägend. Verlottert, den Drogen ergeben und von seinen letzten Euros lebend, vegetiert er verängstigt in Rom vor sich hin: Es ist etwas geschehen in Israel. Mischa ist auf die Lücke im Heilsplan gestoßen. Sie war immer da, doch erst jetzt, in der nihilistischen Gegenwart, wird sichtbar, warum die Evangelien so unbefriedigend abreißen.
Damit aber bohrte sich eine alles aufsprengende Skepsis in die zuvor so tiefe Überzeugung Myschkins hinein: War vielleicht auch die Frömmigkeit des Vorläufers eine zu naive? „Und alles hatte mit der Auferweckung des Lazarus begonnen. Die eben vielleicht, ja wahrscheinlich, nur Illusion war. Eine Inszenierung, auf die der dumme Rabbi hineinfiel … Ein Fake der Jünger.“ Von hier ist es nicht mehr weit zum größtmöglichen Selbstzweifel, der totalen Häresie: Wäre er ohnmächtig, aber lebendig vom Kreuz genommen und nach Rom verbracht worden? Und tatsächlich: Bittet nicht, wie Markus im fünfzehnten Kapitel berichtet, der ehrbare Ratsherr Josef von Arimathia, um den Leichnam Jesu, den er auch erhält, obwohl sich Pilatus wundert, „dass er schon tot war“? „Nicht am Kreuz gestorben, nicht wirklich begraben, nicht abgestiegen zu den Toten, folglich nicht auferstanden! Wenn das die Wahrheit ist, dann bin ich ein Versager.“ Es bleibt aber natürlich – gut cartesianisch – dieses Ich (ich versage, also bin ich), um dessen Wiederaufrichtung inmitten religiöser Trümmer es im Folgenden zu tun ist.
Diese Handlung ist derart verquer, grellbunt, intelligent, aufdringlich, unlogisch und herrlich, mit einem Wort: christlich, dass man Peter Henisch die etwas altbacken wirkende Rahmenhandlung, in der eine ideale – und zwar diesseitige – Liebe aus Adoration, Begehren und Fürsorge entworfen wird, gern verzeiht. Der immer ein wenig unterschätzte Autor aus Wien führt damit fort, was er vor vier Jahren mit der Erzählung „Die schwangere Madonna“ – einer schwangeren Teenagerin nimmt sich hier ein freier Journalist an – begonnen hat: die poetologische Transsubstantiation des biblischen Mythos in aufregend gegenwärtige Prosa.
Am Ende wird Henisch lächelnd milde, stellt anheim, lässt Hintertüren weit offen. Aber auch, wer durch sie entwischt, wer diesen Mischa-Myschkin-Jeschua mit der klassischen Diagnose Schizophrenie loszuwerden gewillt ist, wird von nun an von einer Erinnerung eingeholt werden können, die jenen Urtext hiermit so klug überschrieben hat. Und scheint es nicht tatsächlich so, als würde die kleine Unstimmigkeit im allerhöchsten Zeitplan gerade behoben, als stehe die Apokalypse so unmittelbar bevor, dass selbst die größte Versammlung von Weltherrschern soeben in Kopenhagen die Welt einfach aufgegeben hat? Peter Henisch, dem Christkind sei es geklagt, hat uns das Weihnachtsfest mit einem großartigen Buch infernalisch versaut.
Jesus reloaded
Karl-Markus Gauß, Neue Zürcher Zeitung
In seiner „Geschichte der Leben-Jesu-Forschung“ hat Albert Schweitzer 1908 die Vermutung angestellt, dass Jesus dereinst wieder als Unbekannter unter die Menschen treten werde. Im neuen Roman des mit allen heiligen Wassern der Erzählkunst gewaschenen Peter Henisch kehrt Jesus nicht nur unerkannt auf die Erde zurück, sondern gar als Heimatloser, der seiner eigenen Identität nicht sicher ist.
Als Flüchtling hat Mischa Myschkin durch die Lektüre einer mehrsprachigen Ausgabe der Bibel Deutsch gelernt und dabei eine bestürzende Erfahrung gemacht: Alles, was er im Neuen Testament liest, mutet ihn nämlich vertraut an, er sieht die Schauplätze von Jesu Wundern vor sich, die Gesichter der Apostel, er hat das unabweisbare Gefühl, schon erlebt zu haben, wovon in den Evangelien berichtet wird. Kurz, in ihm wächst der schöne und schreckliche Verdacht, dass er bereits als jener Jeschua gelebt hat, dessen Kreuzestod der Christenheit die Erlösung verheisst. Nun befindet sich der Mann, der glaubt, er sei womöglich der wiedergekehrte Messias, auf dem Weg zu seinen historischen Wirkungsstätten, um sich in Israel und Palästina auf die eigene Spur zu setzen oder endlich die Gewissheit zu erlangen, dass er sich doch geirrt hat.
Der 1943 geborene Wiener Peter Henisch hat schon öfter mit christlichen Motiven, Figuren, Verheissungen gespielt – aber nie auf jene gerade in ihrem blasphemischen Furor so urkatholische Weise, für die die österreichische Literatur genügend grimmige Beispiele kennt; nein, Henisch ist die Sache stets mit respektvoller Ironie angegangen, und in einem Interview hat er zuletzt gemeint, dass sich die Literatur nicht weniger mit „der Sinnfrage“ und „der Erösung“ zu beschäftigen habe als die Religion. Liest man eine knappe Inhaltsangabe, wird einem bange: Kann das gutgehen? Es geht gut, denn Henisch, ein exzellenter Kenner der Evangelien, beherrscht nicht nur seinen Stoff, sondern vor allem das Handwerk des Romanciers.
Auf seiner theologischen Ebene gibt „Der verirrte Messias“ keine Antwort auf die Frage, die Myschkin quält, mit der er aber auch die deutsche Literaturkritikerin Barbara, die er im Flugzeug kennenlernt, wortreich behelligt: Ist er tatsächlich der Wiedergekehrte, mit dem das Ende aller irdischen Tage naht? „Die Apokalypse, ja, das war zu befürchten. Obwohl es nicht so aussah, als ob man ihn dazu noch brauchte.“ Gesetzt, es handelte sich bei ihm tatsächlich um Jesus, wäre er nicht jedenfalls zu spät dran, um die Menschheit zu retten? „Ich bin Jesus. Aber das nützt auch nichts mehr.“
Auf seiner zweiten Ebene erzählt der Roman die charmante Liebesgeschichte zwischen dem russischen Flüchtling, dessen Rededrang ziemlich penetrant ist, und jener rational denkenden Deutschen, die sich fürs Erste streng gegen die fortwährende „spirituelle Belästigung“ verwahrt, aber dann doch in den Bannkreis ihres sonderbaren Reisegefährten gerät. Was, wenn zwar Jesus nicht mehr die Menschheit, aber Barbara, aus deren Sicht der Roman erzählt wird, immerhin diesen einen Heimatlosen zu retten verstünde?
Jedenfalls schreibt Myschkin der Kritikerin, als sie längst wieder in Deutschland ist, einprägsame Briefe aus einem Land, das sich im Kriegszustand befindet. Ihn bedrängen Zweifel, ob sein Tod und seine Auferstehung von den Aposteln vor 2000 Jahren richtig überliefert und nicht absichtlich verfälscht wurden. Mehr noch bekümmert ihn, was er in dem Land sieht, das für heilig gilt und um das sich Israeli und Palästinenser heute so blutig streiten. Da wird der Roman, der ein theologisches Gedankenspiel und eine interkulturelle Liebesgeschichte zu bieten hatte, zur kundigen Reportage über den Nahen Osten. Dass all das in einem einzigen Roman zusammengeht, hat weniger mit einem Wunder als mit der gewissenhaften Erzählkunst des Peter Henisch zu tun.
DU KOMMST SPÄT, MESSIAS
Walter Grünzweig, Der Standard
In Peter Henischs neuem Roman fragt sich ein potenzieller Messias, ob er in Erscheinung treten und das Ende der Menschheit einleiten soll.
Typologien sind ein wichtiges Moment der jüdisch-christlichen Tradition. Das betrifft nicht nur relevante Verweise aus dem Alten ins Neue Testament (etwa von Isaak auf Christus, deren Gemeinsamkeit für die christliche Theologie in der Opferrolle besteht), sondern auch typologische Interventionen in „historischen“ Situationen. Etwa glaubten die Puritaner Neuenglands fest daran, dass sie das zweite Buch Moses nachvollzögen: In der Verfolgung durch England und seinen König fanden sie eine Analogie zur Gefangenschaft der Israeliten im Ägypten der Pharaonen; die biblische Flucht durch das Meer entsprach der Fahrt über den Atlantik; das Gelobte Land konnte nach dieser Logik nur eines sein – die Neue Welt. Auch andere biblische Typologien boten sich an: Wenn sich ein Puritaner beim Zusammentreffen mit den amerikanischen Ureinwohnern auf den missionarischen Spuren des neutestamentlichen Paulus wähnte, konnten die Indigenen noch von Glück reden, denn die Bibel bot auch ganz andere Modelle für den Umgang mit fremden Völkern.
Peter Henischs neuer Roman bedient sich auch der Typologie, allerdings auf eine sehr spezielle und höchst originelle Weise. Die in der Offenbarung des Johannes im letzten Teil des kanonischen Neuen Testaments angekündigte Wiederkunft Jesu erfolgt nicht als Rückkehr eines Weltenrichters. Vielmehr erscheint der potenzielle Messias wie zwei Millennien vorher in Menschengestalt – und zwar in der charakteristischen Figur eines staatenlosen Flüchtlings aus dem Gebiet der ehemaligen UdSSR, der seine überraschenden sprachlichen Fähigkeiten und seine Kenntnisse der Heiligen Schrift in einem deutschen Flüchtlingslager mithilfe einer viersprachigen Gideon-Ausgabe des Neuen Testaments erworben hat.
Religiös motivierte Außenseiterfiguren sind Henischs Werk nicht fremd. Auch Pepi Prohaska, der „Prophet“ des gleichnamigen, erstmals 1986 erschienenen und 2006 überarbeiteten Romans, vermutet, dass Gott etwas Besonderes mit ihm vor hat. Er ist jedoch Prophet und kein Messias und in der ambivalent-ironischen Darstellung Henischs viel stärker der Selbst- und Kulturkritik der verspielten 68er verhaftet als Mischa Myschkin, der ganz deutlich der 89er-Generation zuzuordnen ist und sich den neuen, harten Realitäten der „globalisierten“ Welt stellen muss.
Wie Henischs vor einigen Jahren erschienenes Buch „Die Schwangere Madonna“ ist „Der verirrte Messias“ ein Reiseroman, allerdings einer komplexeren Sorte. Die etwas abgeklärte, beziehungs- und literaturgeschädigte deutsche Rezensentin Barbara – Österreich spielt in diesem Roman Henischs nur eine geringe Rolle – trifft auf einem Flug nach Israel auf den postsowjetischen Migranten. Für seine Andeutungen, er könne in Gottes Auftrag reisen und die letzte Phase der Heilsgeschichte einleiten, hat sie zunächst nur entrüstete Verachtung übrig – eine Haltung, die sich jedoch schnell in Schrecken wandelt, als sie kurz vor dem Beischlaf die charakteristischen Wundmale an ihm entdeckt.
Spirituelle Belästigung
Das Entsetzen der skeptischen Literaturkritikerin hat jedoch nicht so sehr mit diesen Grenzerfahrungen zu tun, sondern mit der Erkenntnis, dass ihr cooler, geschàftstüchtiger Rationalismus zwischen Buchmesse und Verlagsintrigen wesentlich weniger fundiert ist, als sie vermutet hatte. In einer komischen Reflexion wirft sie Mischa nicht sexuelle, sondern vielmehr „spirituelle Belästigung“ vor. Ihr erfolgloser Versuch, sich vom überwältigenden Einfluss dieses Messias zu befreien, weist deutlich auf die spirituellen Defizite der „westlichen“ Kultur – ein unpopuläres, unzeitgemäßes Thema, dessen sich Henisch in seinen Werken nie geschämt hat.
Zwar weigert sich Barbara, Mischa auf seiner Reise zu den Wirkungsstätten von „Jeschua“ zu begleiten; allerdings nur, um durch lange briefliche Berichte umso stärker in dessen Geschichte gezogen zu werden. Mischa versucht nämlich, sich in Israel und den besetzten Gebieten seines Auftrags gewiss zu werden. Als echten Henisch-Protagonisten zeichnet ihn sowohl Besessenheit wie Orientierungslosigkeit aus, ist er zugleich religiös motiviert und sexuell interessiert. Kein Wunder, dass der typologischen Beziehung zwischen Maria („Mirjam“) Magdalena und Barbara bzw. – in deren Absenz – auch Olga, der Gattin eines steinreichen russischen Oligarchen, breiter Raum gegeben wird, ein mit erotischer Energie geladener Raum, in dem sich allerdings der spirituelle Drang der Hauptfigur nicht verliert.
Mischas Suche nach seinen messianischen Wurzeln und Aufträgen führt zu einer faszinierenden parallelen – eben auch typologischen – Darstellung der nahöstlichen Situation vor zweitausend Jahren und heute, insbesondere der Unterwerfung des jüdischen Landes durch die Römer und der Okkupation palästinensischen Lands durch Israel. Der „Lokalaugenschein“ des neuen Messias resultiert jedoch nicht in plakativer tagespolitischer Kritik, sondern trägt zur Vertiefung des Problembewusstseins bei. Auch Figuren wie die vollschlanke, aus Barbaras eifersüchtiger Perspektive sexuell durchaus gefährliche Olga, ein ursprünglich aus Wien stammender, in der Geschichte der Messiaserscheinungen bewanderter Jude namens Edelmann sowie ein Donald-Rumsfeld-Lookalike (oder vielleicht gar Rumsfeld selbst), der den neuen Messias für die amerikanische christliche Rechte rekrutieren will, verbinden die Erlebnisse des Zeitenwanderers mit einem sehr konkreten Hier und Jetzt. Was da geboten wird, ist politische und Kulturkritik, ironisch, sarkastisch, bis an die Grenze zum Slapstick.
Ob Mischa nun tatsächlich ein Wiedergänger Jesu ist, bleibt selbstverständlich offen (und die Ereignisse um Barbara und Mischa im letzten Teil des Romans, der in Rom spielt, sollen der Spannung halber hier nicht erwähnt werden). Eine der Fragen, die sich Mischa immer wieder stellt, ist, ob er, sollte er als Messias „in Erscheinung treten [oder] … sich, um ein zeitgemäßeres Wort zu verwenden, „outen“, das Ende der Menschheitsgeschichte einleiten würde. Die ernüchternde Antwort darauf gibt er sich selber mit bitterem Humor: „Die Apokalypse, ja, das war zu befürchten. Obwohl es nicht so aussah, als ob man ihn dazu noch brauchte.“
Der Witz an Henischs Buch ist eben, dass dieser verirrte Messias im Grunde zu spät kommt. Auch ohne ihn scheint man an das Ende der Geschichte gekommen zu sein. Sodass das auf der Umschlagrückseite abgedruckte lapidare Statement, mit dem Mischa sich der Oligarchin Olga vorstellt, zu einer fast theologischen Aussage wird: „Ich bin Jesus, sagte er. Aber das nützt auch nichts.“ Dieses Eingeständnis messianischer Machtlosigkeit erinnert an den Jesus-Roman Norman Mailers, in dem der Messias ebenfalls Selbstzweifel und Orientierungslosigkeit Ausdruck gibt. Es negiert jedoch nicht Mischas Ringen um seine Identität und um die ihm gestellte Aufgabe. Gerade in der Beharrlichkeit, mit der er seine oft erfolglos scheinende Suche verfolgt, liegt das trotz allem optimistische Moment des Buchs.
Obwohl Henisch seinen ehemaligen Religionslehrer Adolf Holl in den Danksagungen erwähnt, ist sein Umgang mit der Schrift ein primär literarischer, der auf deren narrative Qualitäten abzielt. Gerade dadurch gelingt ihm der Brückenschlag zwischen den Zeiten: Der verirrte Messias übersetzt die neutestamentlichen Erzählungen in unser zielloses Zeitalter der Globalisierung.
OB ER WIRKLICH DIE WELT RETTEN SOLL?
Peter Pisa, Kurier
Neue und alte Jesus-Geschichten. Peter Henisch geht in „Der verirrte Messias“ volles Risiko. Und gewinnt. Weil er sich zwar spielt, aber ernst bleibt. „Bei den Evangelien kenne ich mich aus“: Peter Henisch hat den Roman seinem einstigen Religonslehrer Holl zum Kontrollieren gegeben, „aber er hat keine Fehler gefunden“.
Es war ein doppelter Schock. Zum einen, weil Peter Henisch den vertrauten Blick durchs trübe Wiener Fenster so demonstrativ verlassen hat und eine Deutsche namens Barbara auf den Frankfurter Flughafen setzt. Brauchen wir das von ihm? Von der Buchmesse kommt sie. Barbara ist Kritikerin und will ihre Halbschwester in Israel besuchen.
Ehe man sich fasst, redet jemand Barbara an.
Myschkin heißt er – ein Flüchtling aus Russland, der im Lager die Bibel studiert hat und sich erinnert: „Das bin doch ich! Jesus, das könnte ich sein!“
Myschkin geht sozusagen auf Lokalaugenschein. Er ist auf seiner eigenen Spur unterwegs. In Israel will er sich Klarheit verschaffen, ob er wirklich der wiederkehrende Messias ist und die Welt retten soll.
Oder ist die Welt damit sowieso zu Ende?
Wenn Myschkin aufgeregt ist, im Bett mit Barbara zum Beispiel, so blutet er an Händen und Füßen.
Und das ist der zweite Schock. Angst ist es: vor Henischs Scheitern. Aber weil er – zwar verspielt (ein Büchl von Dan Brown wird zornig weggeworfen) – ernst bei der Sache bleibt, scheitert er nicht.
Es wird genügend Leute geben, die damit nichts anfangen. Aber es funktioniert. Seltsam, dass es geht.
Es ist sogar erfreulich, zwischendurch alte Bibelgeschichten frisch erzählt zu bekommen. Schwer ist die Bedeutung, doch man folgt dem Weg nie niedergedrückt.
Und wird das Gefühl nicht los, einen solchen Roman um einen möglichen Jesus hätte der suspendierte Priester, Theologe und Autor Adolf Holl gern geschrieben.
Tatsâchlich war Holl im Gymnasium Ettenreichgasse Henischs Oberstufen-Religionslehrer …
KURIER: Warum kommen Sie uns mit Religion?
Peter Henisch: Man darf Religion nicht mit unserem Alpintrottelkatholizismus verwechseln. Die wirkliche Religion hat mir nichts angetan. Ich bin nicht geschädigt. Als junger Mann habe ich Camus gelesen und die Bibel. Wenn ich mich wo auskenne, dann bei den Evangelien. Die Sinnfrage, die Erlösung – das interessiert die Religion und die Literatur.
KURIER: Jesus surft bei Ihnen nicht übers Wasser.
Peter Henisch: Nein. Das wäre, an der Oberfläche zu bleiben. Ich bin in einem anderen Stockwerk. Bei mir ist das nicht nur ein Gag. Man kann ironisch damit umgehen. Aber ich denunziere den Ernst nicht. Es geht ja immerhin um Leben und Tod. Es geht darum, ob die Menschen zu retten sind.
KURIER: Zusätzlich ist „Der verirrte Messias“ noch eine Liebesgeschichte.
Peter Henisch: Und was für eine! Der Mann, der vielleicht Jesus ist, will die Welt retten. Aber eine Frau rettet ihn. Sie bringt ihn vom Heroin weg. Sie rettet ihn unter anderem mit Sex. Auch das noch.
KURIER: Rechnen Sie mit dem Vorwurf der Blasphemie?
Peter Henisch: Der Roman wird Feinde haben. Er spielt hier und jetzt, aber er geht zurück bis in Marias Mutterleib.
KURIER: Wünschen Sie sich, dass Jesus auftaucht und hilft?
Peter Henisch: Ich lass‘ ja lieber offen, ob es wirklich Jesus ist. Das könnte sonst peinlich werden. Brauchen, brauchen könnten wir ihn schon. Aber vielleicht genügen die 99 Gerechten, die die Welt im Geheimen aufrecht erhalten.
BLACKOUT IN JERUSALEM
Brigitte Schwens-Harrant, Die Presse
„Der verirrte Messias“: In Peter Henischs Roman will der russische Flühtling Mischa schon einmal gelebt haben – just als Jesus. Barbara, die Sitznachbarin im Flugzeug, glaubt ihm das nicht ganz.
„Schon viele haben versucht, eine fortlaufende Erzählung von den Ereignissen zusammenzustellen, die sich unter uns begeben haben“, zitiert Peter Henisch den Evangelisten Lukas, jenen „Fabulierer, der die Fakten, an die sich irgendwelche dubiosen Zeitzeugen angeblich erinnern, fürs hellenistische Publikum dekoriert.“ Dies meint Mischa, Held in „Der verirrte Messias“ und seinerseits ein glänzender Fabulierer vor dem Herrn, der seine Geschichten vor allem für sein staunendes Gegenüber, die Literaturkritikerin Barbara, aufs Feinste dekoriert.
Schon viele Autoren haben versucht, die neutestamentlichen Texte nachzuerzählen, für das je zeitgenössische Publikum aufzubereiten und auszuschmücken, die Sehnsucht nach Klatsch (hat Jesus nun mit Maria Magdalena, oder hat er nicht?) ebenso zu befriedigen wie die nach Erklärungen (wie war das mit der Auferstehung wirklich?). Viele Romane sind so entstanden, kitschige wie „Mirjam“ von Luise Rinser, provokante wie „Das Evangelium nach Jesus Christus“ von José Saramago – und es scheint kein Ende der Versuche zu geben, auch kein Ende des Begehrens der Leser nach mehr.
Nach mehr. Denn in gewisser Hinsicht sind die Evangelien enttäuschend verschwiegen, widersprüchlich auch. Wieso ist der Geist, der einen doch mit aller Wucht ergreift, eine Taube und kein Habicht? Wieso weiß Johannes nichts vom Abendmahl, die drei Synoptiker nichts von der Fußwaschung? (Eine Frage, die der polnische Autor Pawel Huelle in seinem neuesten Roman, „Das letzte Abendmahl“, übrigens zwei seiner Protagonisten diskutieren lässt.) Das Neue Testament: Textsorten aus unterschiedlichen Zeiten, mit unterschiedlichen Interessen und an unterschiedliche Adressaten gerichtet – und viele offene Fragen. Ungeheuerlichkeiten wie Wunder oder gar die Auferstehung, die überliefert, als „wahr“ und Kern des christlichen Glaubens empfunden wird, und die bleibenden nagenden Fragen: Wer erzählt da? Ist er glaubwürdig? Wo kann ich heute in dieser Welt die Erlösung sehen?
Die Evangelien provozieren – und veranlassen zum Ausmalen, Weiter- und Umerzählen. Jesus bekam mehr Kindheit, Maria Magdalena mutierte von der Berufenen zur Sünderin, um den männlichen Jüngern nicht mehr so gefährlich nahe zu stehen (und womöglich auch Nachfolge einzufordern): Jahrhundertelang schrieben nicht nur Exegeten, sondern auch bildende Künstler und Literaten die Bibel weiter – und die Ergebnisse erzählen viel über die jeweiligen Gestalter und ihre Projektionen. Kitschfallen stehen für all jene bereit, die sich künstlerisch der Bibel annehmen: psychologische und emotionale Ausschmückungen, die Wahl von Erzählperspektiven, die alles besser wissen und erklären können, historisierende Gewänder, unreflektierte Übernahme klischierter Bilder. Wie aber meidet man solche Fallen? Wie kann man sich im Jahre 2009 literarisch mit der Geschichte Jesu auseinandersetzen, und macht das überhaupt einen Sinn?
Messias mit Schafsprofil
Nicht um der Literaturgeschichte einen weiteren Jesusroman hinzuzufügen, greift Henisch die biblischen Geschichten auf: Nichts Geringeres als die Erlösung steht auf dem Spiel. Kenner seines Werks, etwa der Gedichte in „Hamlet, Hiob, Heine“ oder des Romans „Pepi Prohaska Prophet“, wird eine solche Thematik nicht überraschen. Den letzten Anstoß zum Schreiben dürfte aber ein anderer literarischer Versuch gegeben haben, jener der US-Autorin Anne Rice, die mit Vampirromanen berühmt wurde, dann aber beschloss, sich „ganz der Aufgabe zu widmen, Jesus Christus zu verstehen“. In Henischs Rezension ihres Romans „Jesus Christus. Rückkehr ins heilige Land“ im „Spectrum“ vom 6. Oktober 2007, kann man viel über die Widerstände des Autors erfahren gegen Rices Erzählweise, die ihn „frappant an jene Walt-Disney-Filme erinnert hat, die es geschafft haben, so gut wie alle literarischen Vorlagen auf ein Niveau gut gemeinter Niedlichkeit zu reduzieren“. Henisch stößt sich etwa an dem Versuch, so detailreich die Wirklichkeit von damals nachzukonstruieren, „dass einem das realistische Herz im Leib lacht“. Nachzulesen ist aber auch, wie Henisch in dieser Rezension seine Idee einer anderen literarischen Möglichkeit entwickelt, sich an diesen Stoff heranzuwagen.
Spuren davon, dass die Lektüre dieses Buches eine Rolle spielte, kann man in Henischs Roman finden, schon auf der zweiten Seite ist ein Empfang im Verlag bei Hoffmann und Campe erwähnt, bei dem sich Mischa und die Literaturkritikerin getroffen haben sollen, später wird der Hinweis verstärkt: „Diese amerikanische Bestsellerautorin, die durch eine endlose Serie von Vampirromanen berühmt geworden, nun, zur Verwirrung ihrer Fangemeinde, auf einmal ein Buch über Jesus geschrieben hatte.“
Nein, Henisch hat kein Interesse, aus einer anmaßenden Ich-Perspektive den Leser über alle Klitzekleinigkeiten der Kindheit Jesu zu informieren, über die Rice wie manche apokryphen Evangelien bestens Bescheid zu wissen vorgibt, die die kanonisierten Evangelisten aber nicht erzählen wollten. Der letzte Satz in Henischs Rezension denkt eine erfrischend andere Verfahrensweise an: Beim Lesen habe ihn eine Sehnsucht erfasst nach einer Alternative wie Monty Python’s „Leben des Brian“. Wer Henischs Bücher kennt, der weiß, dass ohne Humor nichts geht, schon gar nicht Gottsuche. „Wo bitte geht’s hier zu Gott? / Wer Dich ernsthaft sucht / Ist eine Lachnummer“, heißt es in den „Psalmen“ des Propheten Pepi Prohaska, eines der ebenso liebenswerten wie verrückten Gottsucher aus Henischs Feder, durchaus ein Verwandter Mischas (dessen Name nicht zufüllig auf Dostojewskis Roman „Der Idiot“ verweist).
Um eine ernsthafte und existenziell wichtige Suche geht es auch im „Verirrten Messias“, um die verzweifelte Suche nach sich selbst und um die damit verbundene Frage, wie es um die Erlösung steht. Es beginnt mit einer Provokation. Im Flugzeug nach Tel Aviv findet Barbara diesen Mischa neben sich sitzen, einen Mann mit „Schafsprofil“, der der verblüfften Literaturkritikerin erklärt, den Büchern fehle der heilige Geist. Wie sie gegen ihren Willen erfährt, ist er ein Flüchtling aus dem Gebiet des zusammengebrochenen Kommunismus, sein Leben habe sich verändert, als er begann, die Schrift zu lesen. Da kam ihm einiges bekannt vor: „Als hätte er dies und das schon einmal geträumt.“ Nach und nach habe er sich erinnert, wer er sei, nämlich Jesus. Einen solchen Sitznachbarn wünscht sich eine intelligente Frau nicht unbedingt an ihrer Seite. Nach einer Zwischenlandung in Rom werden sich ihre Wege in Israel trennen, er wird ihr aber von seiner sonderbaren Reise durchs Land Briefe schreiben und E-Mails, sie wird ihn nicht mehr los.
Mit Mischas Erzählungen von der Kindheit als Jeschua betritt Henisch ein heikles literarisches Terrain: Erinnern solche Erzählungen doch an jene Jesusliteratur, die versucht, den Protagonisten die alten Gewänder anzuziehen und die Zeit Jesu wieder aufleben zu lassen. Darauf kommt es Henisch nicht an, und sein literarischer Trick, dass diese „Erinnerungen“ Briefe (eines verrückten?) Mischa an Barbara sind, die wir aus ihrer Perspektive wahrnehmen, enthebt ihn des Verdachtes, historisierende Bedürfnisbefriedigung zu betreiben. Im Gegenteil: Henisch fühlt erzählend der Verlässlichkeit der Zeugen auf den Zahn. Das beginnt mit der Wahl dieses auf den zweiten Blick zwar faszinierenden, aber alles andere als vertrauenswürdigen Protagonisten, nimmt aber auch die Bibel als Literatur davon nicht aus: „Ja, so steht es bei Johannes. Aber kann man diesem Schriftsteller trauen? Ich weiß nicht, ob man überhaupt irgendeinem Schriftsteller trauen kann!“
Henisch zieht in dieser Liebesgeschichte den Leser in ein Wechselbad der Gefühle: Anziehung und Abstoßung, Nähe und Ferne, Glaube und Zweifel. Ein solches Hin und Her „plagt“ nicht nur Liebende, sondern auch Gläubige oder Bibelleser. Mit Barbara fragt sich der Leser: Kann man Mischa trauen? Oder ist er nur ein Spinner? Dass die Erinnerungsbilder an seine Kindheit in einem Museum aufgefrischt und in einem Amsterdamer Coffeeshop besonders färbig werden, spricht dafür. Oder ist doch was dran an seinem „Selbstbewusstsein“? Warum wird er vom Hirten „erkannt“? Warum zuletzt beim Brotbrechen? Und: Kann Barbara überhaupt ihren eigenen Augen trauen, etwa wenn sie Mischas Stigmatisierungen sieht? – Das Sympathische am Buch ist, dass es nichts abschließend erklärt. Eher setzt es eine nachhaltige Verstörung in Gang. Verstört wird auch Mischa, dessen Fabulierlust und Sendungsbewusstsein just da an ihr abruptes Ende kommen, wo es um alles geht. Nachdem ihm auf seiner Reise durch das Israel von heute gelungen ist, sich wiederzuerinnern, wartet in Jerusalem das große Blackout auf ihn. Wie (seine) Kreuzigung und Auferstehung denken? Da setzt auch Mischas bisher blühende Fantasie aus – oder sein Erinnerungsvermögen. Vielleicht wurde er als Jesus nicht gekreuzigt – oder vorzeitig vom Kreuz genommen und auf ein Schiff nach Rom gebracht: „Wenn das die Wahrheit ist, dann bin ich ein Versager!“ In Jerusalem ist Mischa mit seinem Latein am Ende. Hat die Erlösung je stattgefunden? Solche Zweifel führen ins Bodenlose: „Dem Christentum, sagte er, und zwar nicht nur meinem, ist ja allem Anschein nach der Boden unter den Füßen weggezogen.“
An theologischen Kernen knabbern
Henisch löst die Unsicherheit über die Identität seines Helden nicht auf, und die Frage nach der Erlösung stellt er als dringende. Die Mauer, die heute jenen Ort teilt, an dem einst die Auferweckung des Lazarus stattgefunden haben soll, erzählt nicht gerade von einer erlösten Welt. Doch neben dem Zweifel, der den Protagonisten in die Verzweiflung stürzt, ist ja auch (vorläufige) Rettung durch Barbara zur Hand, und es kommt zu weiteren, letztlich unerklärlichen Begebenheiten. Gerade aufgrund dieser Unsicherheiten liest sich Henischs Roman als glaubwürdigere Annäherung an das „Geheimnis des Glaubens“ als die Literatur jener, die schreibend alle Ungereimtheiten aus dem Weg räumen wollen.
Henisch wäre nicht Henisch, würde er nicht herzerfrischend witzige Einfälle einbringen: So sieht jener Widersacher, der als Vertreter der Christian Coalition Mischa euphorisch begrüßt und geradezu verfolgt, wie Donald Rumsfield aus. Auch Kritik streut der bibel- und theologieversierte Autor in seinen Roman: etwa wenn die Kirchen, besonders die Verkündigungskirche in Nazareth, Mischas Wiedererkennen im Heiligen Land im Weg stehen oder wenn er Mischa und den Hirten in ihrem Dialog an theologischen Kernen knabbern lässt.
„Die Geschichte beginnt ja in der Gegenwart“, sagt Barbara, die Literaturkritikerin, zu Richard, dem Historiker, und es ist die Geschichte, die Henisch schreibt. „Allerdings reicht sie weiter zurück in die Vergangenheit, und womöglich reicht sie auch irgendwie in die Zukunft. Was weiß ich? Eine ziemlich verrückte Geschichte.“
PETER HENISCH: SEIT LANGEM EIN EIFRIGER BIBELLESER.
Norbert Mayer, Die Presse
Schon der erste Prosatext des späteren Schriftstellers Henisch war vom Religionsunterricht (und seinem Religionslehrer Adolf Holl) inspiriert. Sein jüngstes Werk, „Der verirrte Messias“ hat also eine lange Vorgeschichte.
Sie wenden sich erstaunlich oft in Ihren Büchern der Religion zu, wie eben erst in Ihrem neuen Roman „Der verirrte Messias“ (Deuticke). Ist das Zufall?
Peter Henisch: Das Thema ist für mich nicht vom Himmel gefallen, ich trage es schon ziemlich lange mit mir herum. Etwas ironisch eingesetzte religiöse Motive klingen zum Beispiel in Romanen wie „Die schwangere Madonna“ und „Pepi Prohaska Prophet“ an. Bei Pepi Prohaska geht es auch um jemanden, der glaubt, einen Auftrag von Gott zu haben.
Aber diesmal gehen Sie noch einen Schritt weiter.
Peter Henisch: Der Protagonist von „Der verirrte Messias“ ist eine andere Mischung. Darauf weist schon sein Familienname hin, derselbe wie jener der Hauptfigur aus Dostojewskis Roman „Der Idiot“. Den verwendet mein Messias, den schreibt er als Absender auf seine Briefe. Das ist vielleicht Chuzpe, aber die Frau, die er mit diesen Briefen belästigt – anfangs wirkt er auf sie ja fast wie ein Stalker –, diese Frau ist Literaturwissenschaftlerin: Ihr versucht er sich durch diesen Namen kenntlich zu machen.
Ihr Verirrter, eine Art wiedergekommener Heiland, der sogar Stigmata hat, liest das Neue Testament in einer viersprachigen Ausgabe. Und behauptet, es war damals, als er zum ersten Mal da war, ganz anders. Ist das auch Ihre Exegese?
Peter Henisch: Mischa Myschkin versetzt sich in die Situation des Herrn Jesus, der wahrscheinlich keine Ahnung gehabt hat, dass man ihn je Christus nennen wird. Die Idee seiner Jünger, dass er der Messias sein soll, hat Jeschua wohl mit einer gewissen Reserve gesehen. Vielleicht lässt er sich nach und nach darauf ein, in den synoptischen Evangelien kann man Spuren dieser Art von Bewusstwerdung finden. Aber dass er alles von vornherein weiß und nie an sich zweifelt, wie bei Johannes, das wäre ja eigentlich gerade das Gegenteil der Menschwerdung, die doch als Voraussetzung der Erlösung gilt.
Haben Sie Tabubrüche einkalkuliert?
Peter Henisch: (Lacht) Es gibt eine Stelle, in der in Rom ein Buch von Dan Brown aus dem Fenster geworfen wird. Vielleicht ist das für manche der größte Tabubruch. Ach ja, und am Ende, als er im Zweifel, in der Verzweiflung zu versinken droht, da kokst mein Messias. Aber Barbara, die Frau, mit der sich nach und nach eine ganz eigenartige Liebesgeschichte entwickelt hat, versucht, ihn da rauszuholen.
Sind Sie ein eifriger Bibelleser?
Peter Henisch: Seit Langem. Die Luther-Bibel zum Beispiel ist doch das Basismaterial der deutschen Sprache. Bert Brecht hat sie geliebt, und auch der Philosoph Ernst Bloch, über den ich eine unvollendete Dissertation geschrieben habe. Im Unterschied zu den meisten Autorenkollegen meiner Generation in Österreich habe ich diese Lektüre nie als reaktionär empfunden.
Wie sind Sie konkret auf das Thema gekommen?
Peter Henisch: Vor zwei Jahren, nach der Fertigstellung des Romans „Eine sehr kleine Frau“, habe ich mich zum Lesen in mein italienisches Refugium zurückgezogen. Einfach frei lesen, habe ich gedacht. Ohne besonderen Plan. Ich lese dort gern auf Italienisch. Unter den vorhandenen italienischen Büchern war eine exzellente Bibelübersetzung mit Kommentaren. Da habe ich mich also in die Evangelien vertieft. Das sind Texte, die ich gut kenne, aber in einer anderen Sprache wirkte vieles neu. „La potenza di Dio“, die über die Jungfrau Maria kommen soll, hört sich zum Beispiel anders an als „Die Kraft des Allerhöchsten“. Da hab ich mir Notizen gemacht und schon mit dem Gedanken gespielt, eine etwas andere Jesus-Geschichte zu schreiben.
Und wie wurde es dann konkret?
Peter Henisch: Ich sollte auf Empfehlung von Adolf Holl für das „Spectrum“ ein Buch von Anne Rice besprechen, die hat eine Reihe von Vampir-Romanen geschrieben. Auf ihre alten Tage ist sie offenbar fromm geworden und hat eine Jesus-Trilogie verfasst. Den ersten Band, „Rückkehr ins Heilige Land“, sollte ich rezensieren. Das Buch ist gut gemeint, so viel kann man sagen – lieb amerikanisch, als ob Walt Disney in den Fünfzigerjahren einen Jesus-Film gemacht hätte, mit all den frommen Legenden. So nicht, habe ich mir gedacht.
Adolf Holl war Ihr Religionslehrer. War das ein nachhaltiger Einfluss? Auch er hat außergewöhnliche Bücher über Jesus geschrieben.
Peter Henisch: Dass ich Holl in der Oberstufe als Lehrer bekommen habe, war entscheidend. Vorher war der Religionsunterricht echt jenseitig, nun war er auf einmal interessant. Ich komme nicht aus einem religiösen Haus, bin also nicht vom Katholizismus geschädigt. Ich musste keine Verletzungen abarbeiten, wie etwa mein Kollege Josef Winkler. Der landläufige Katholizismus und das Christentum passen für mich nicht unter einen Hut. Holl, damals ein junger Kaplan, hat uns einfach andere Perspektiven ahnen lassen.
Was hat er denn gemacht?
Peter Henisch: Er hat die philosophisch interessierten Schüler für sich gewonnen. Damals, bevor es von oben gebremst wurde, sah die Befreiungstheologie noch wie eine gleichzeitig idealistische und realistische Perspektive aus. Was mich am Christentum und am Judentum, aus dem es ja kam, anzog, hatte jedenfalls wenig bis nichts mit einer konservativ autoritätsgläubigen Lebenshaltung zu tun. Holl war anders als alle anderen Lehrer. Ich habe mich auf seine Stunden gefreut.
Hat sich das literarisch ausgewirkt?
Peter Henisch: Mein erster Prosatext war tatsächlich von einer Frage im Religionsunterricht inspiriert. Es ging um einen Fall von Tötung nach Verlangen. Da hat einer seinen Bruder, einen unheilbar Kranken, auf dessen Verlangen umgebracht. Das war ein konkreter Fall in Frankreich, den wir im Unterricht diskutierten, ich habe den Vorfall in meiner Geschichte ins Inzersdorfer Ziegelwerk verlegt. Dostojewski und Camus haben mich damals auch schwer beeinflusst. Aber Holl hat mir „the doors of perception“ geöffnet.
Hat Herr Holl Ihr Buch gelesen?
Peter Henisch: Ich habe ihn ersucht, das Manuskript vor Erscheinen zu lesen und mich auf eventuelle sachliche Fehler hinzuweisen, aber er hat keinen gefunden. In den Realien bestens beschlagen, hat er gesagt. Das freut mich natürlich. Dieser Jesus-Roman, hat er gesagt, ist ein Lichtblick. Auf jeden Fall ist dieses Buch viel weniger langweilig als das des Herrn Ratzinger.
Ist es Ihnen leichtgefallen?
Peter Henisch: Ich habe es nicht einfach aus dem Ärmel geschüttelt. Im Grunde genommen hat sich dieses Buch seit meinen Anfängen als Schriftsteller vorbereitet. Man kann das schon in sehr frühen Arbeiten von mir nachlesen. Ein Kurzprosatext mit dem Titel „Lazarus“ etwa ist 1970 in der damals sehr ambitionierten Literaturzeitschrift „Konfigurationen“ erschienen. In gewisser Hinsicht war diese poetisch-experimentelle Prosa der Keim zum nun vorliegenden Roman.
Der hat also eine lange Vorgeschichte…
Peter Henisch: Ja, es gibt viele Verbindungslinien zu früheren Büchern von mir. Etwa zu „Morrisons Versteck“, das scheint mir jetzt in mancher Hinsicht wie eine Vorarbeit zu diesem Buch. Oder im „Hiob“-Zyklus, an dem ich jahrzehntelang geschrieben habe. 1971 wurden Proben daraus in der „Neuen Rundschau“ veröffentlicht, vorläufig zwischen zwei Buchdeckeln aufbewahrt steht er dann 1989 in meinem Gedichtband „Hamlet, Hiob, Heine“ – die letzten Dinge haben mich einfach immer interessiert.
Wie stehen Sie also zu diesen letzten Dingen?
Peter Henisch: Bei aller Liebe zur Ironie setze ich mich ernsthaft mit dem Thema auseinander. Die angeblich schon absolvierte Erlösung, und warum man so wenig davon merkt. In einer Welt, in der mein verirrter Messias hilflos vor einer Mauer steht, die das sogenannte Heilige Land in zwei Teile spaltet. Ausgerechnet an dem Ort, an dem angeblich Lazarus auferweckt wurde.
GANZ KURZ:
1. … ob Sie an ein Leben nach dem Tod glauben?
Die wahrscheinliche Endgültigkeit des Todes stört mich jedenfalls. Dagegen schreibe ich an.
2. … was für Sie eine Todsünde ist und was eine lässliche?
Die Todsünde: der absolute Mangel an Liebe. Die lässliche: die relative Verirrung im Leben.
3. … was Sie von Judas halten?
Womöglich ein frommer Mensch. Wahrscheinlich ein armer Hund. „I feel used“, sagt er ganz richtig in „Jesus Christ Superstar“.
4. … und vom Teufel? Mit C.G. Jung gedacht: der Schatten Gottes.
KOMMENTARE von Presselesern finden Sie am Ende des on-line Artikels
ISRAELREISE MIT DEM MESSIAS
Christian Schachenreiter, OÖNachrichten
Peter Henisch ist etwas Außergewöhnliches gelungen: ein Jesus-Roman, der doofe Glorifizierung ebenso konsequent vermeidet wie blasphemische Diffamierung.
Barbara ist eine Unerlöste unserer Zeit. Sie ist 39, nach einer unrunden Beziehung mehr oder weniger glücklich getrennt, folglich Single, kinderlos und von Beruf – das Schicksal kann gnadenlos sein! – Literaturkritikerin. Während einer Flugreise nach Israel mit unerwünschtem Zwischenstopp in Rom wird Barbara die Bekanntschaft eines jüngeren, seltsamen Mannes aufgedrängt. Der aus Russland stammende, aber in Deutschland lebende Mischa ist ein leidenschaftlicher Leser der Bibel, vor allem des Neuen Testaments. Anfangs benützte er eine viersprachige Ausgabe rein pragmatisch zum Spracherwerb, aber so nach und nach begann ihn das Leben und Leiden Jesu zu faszinieren – bis zu dem problematischen Zeitpunkt, an dem Mischa den halbhellen Eindruck gewann, er lese da seine eigene Geschichte, die Geschichte eines früheren Lebens – naja …
Der wiedergeborene Messias begibt sich an die Stätten seines früheren Wirkens, um den spektakulären Ereignissen der Vergangenheit nachzuspüren. Barbara hält er über seine Erfahrungen auf dem Laufenden, und so gerät sie, die anfangs eher mit verdrossener Ablehnung auf den wiedererstandenen Messias reagiert hat, in seinen Sog und wird letztlich zu einer Begleiterin, deren liebevolle Fürsorge selbst Maria aus Magdala alle Ehre gemacht hätte. Spinnt dieser Mischa einfach nur? Oder ereignet sich vielleicht doch etwas Mysteriöses?
Die spirituellen Rätsel löst Henisch klugerweise nicht auf. Vielmehr geht es ihm darum, anhand des fiktiven Plots die folgenreiche Lebens- und Leidensgeschichte Jesu für unsere heutige Vorstellungswelt nachvollziehbar zu machen – so weit dies eben möglich ist. Das führt bisweilen zu überraschenden, bemerkenswerten Sichtweisen, zu ironischem Achselzucken und auch zu skeptischer Distanzierung. Man merkt, dass Peter Henisch unbelastet an die Bibel herangeht – unter österreichischen Autoren eher eine Rarität. Henisch hat keine Kindheit zu bewältigen, die durch eine wüste katholische Erziehung beschädigt worden wäre. So braucht er sich auch nicht durch rabiate Blasphemie distanzieren.
Mit seinem Roman „Der verirrte Messias“ zeigt Peter Henisch eindrucksvoll, dass man die Bibel nach wie vor ernst nehmen kann, ohne deswegen in vorkritische „Blödsichtigkeit“ (G. Ch. Lichtenberg) zu verfallen. Es gibt aber noch einen guten Grund, diesen Roman zu lesen: den schönen epischen Sound seines Stils.